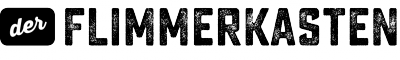„Maybe I’m happy and I just don’t know it.“
Es gab mal eine Zeit, so um die Jahrtausendwende (ein tolles Wort), da war die amerikanische Anwaltsserie „Ally McBeal“ sehr angesagt. Danach kam „Sex and the City“, später „Desparate Housewives“, und verglichen mit ihren Nachfolgern wirkt Ally fast ein wenig unschuldig.
Ally McBeal kündigt ihren Job in einer Anwaltskanzlei, als ihr Chef sie sexuell belästigt, findet aber kurz darauf eine neuer Stelle in einer Kanzlei, die ihr ehemaliger Schulkamerad Richard Fish sich mit dem merkwürdigen John Cage teilt – in Boston. Kein Problem, Ally zieht um – und die Serie nimmt ihren Lauf.
„Ally McBeal“ ist tragikomisch – im Gegensatz etwa zu „Sex and the City“, wo, allen Problemen zum Trotz, meist die Komik überwiegt. Aber Ally, die neurotische Anwältin, die sich mit männerverschlingenden Sekretärinnen, verheirateten Ex-Freunden als Kollegen und flüchtenden Verlobten herumschlagen muss (von ihrem Job ganz zu schweigen), ist immer einsam. Oder, fast immer.
Zentrum der Serie ist die Unisex-Toilette der Anwaltskanzlei, in der man sich furiose Wortgefechte liefert und imaginäre Schlachten: „Ally McBeal“ enthält gelegentlich witzig-phantastische Einlagen, in denen Allys Gedanken visualisiert werden. Beispielsweise beißt sie ihrem Gegenüber mal eben den Kopf ab.
Allabendlich versammeln sich die Verdammten der Kanzlei in einer Cocktailbar, wo Vonda Shepperd singt. Für letztere, und natürlich für Calista Flockheart, war die Serie ein Karrieresprungbrett. Mit der fünften Staffel, deren Handlung drastisch verändert werden musste, als Robert Downey Jr. wegen Drogenbesitzes ins Gefängnis musste, verliert „Alley McBeal“ allerdings deutlich an Tempo und Witz. Jon Bon Jovis Nebenrolle hätte man sich ebenfalls sparen können.
„Ally McBeal“ ist ein funkelnder Cocktail; mal witzig, mal tottraurig, aber – meistens – sehr unterhaltsam. Im deutschen Fernsehen brauchte sie zwei Anläufe, ehe sie im Abendprogramm von Vox einen treuen Zuschauerstamm fand, der ihren schrägen Geschichten folgte.